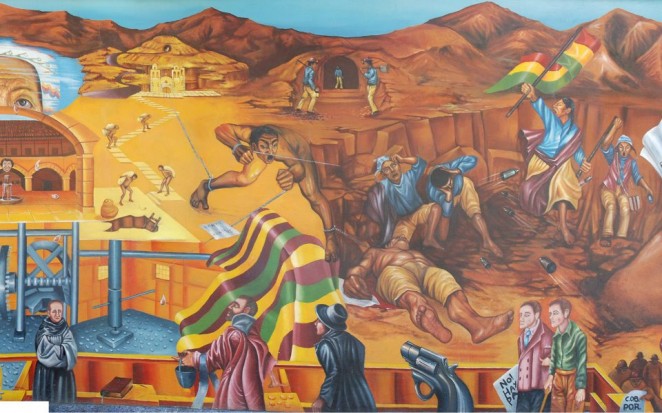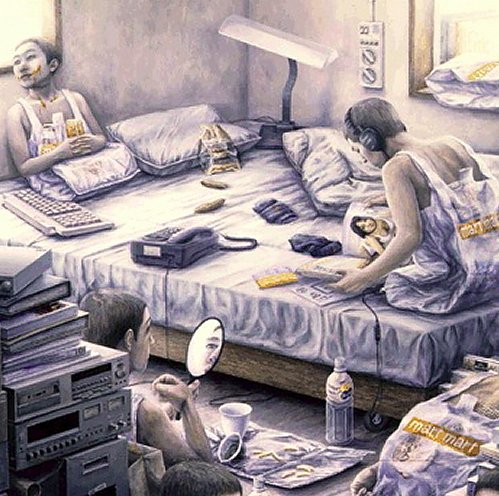Viele Linke vertreten die Theorie, dass der Rüstungssektor eine Art Motor des Kapitalismus ist, der angeworfen werden kann, wenn der Rest der Industrie keine hinreichenden Profite mehr abwirft. Die beiden türkischen Ökonomen Pelin Akçagün-Narin und Adem Yavuz Elveren haben sich diesen Zusammenhang empirisch genauer angeschaut. Lässt sich ein statistisch belastbarer Zusammenhang zwischen fallender Profitrate, einem wachsenden Finanzsektor und steigenden Rüstungsausgaben aufzeigen.
Weiterlesen