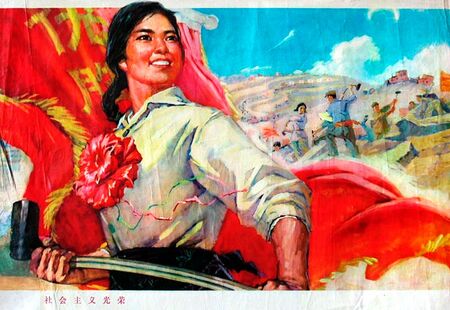Die Zerstörung sowjetischer Symbolik im öffentlichen Raum hat nach den Jahren um 1990 im Zuge des Ukraine-Konflikts ein zweites Mal an Fahrt angenommen. Łukasz Wiktor Olejnik zeigte in der European Politics and Society, dass der Prozess jedoch umstritten ist. Obwohl der Antikommunismus in Polen fester Bestandteil der modernen Nationalerzählung ist – nahezu gleichrangig mit dem Katholizismus –, hat sich die regierende konservative PiS-Partei nicht nur Freunde mit ihren Gesetzen zur Tilgung des sozialistischen Erbes gemacht. In die Wahlgebieten, in denen Straßennamen sehr strikt geändert wurden, hat sie anteilig weniger Wähler*innen in den letzten Jahren gewonnen als in anderen Wahlkreisen. Warum ist das so und was sind die Hintergründe der polnische Kommunisierung und Dekommunisierung?
Weiterlesen