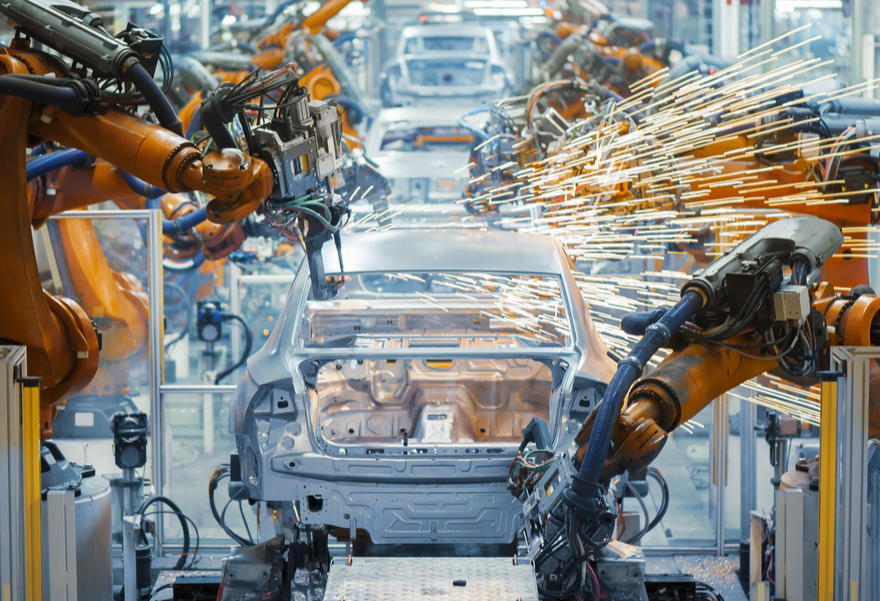Angesichts der Tatsache, dass der Kapitalismus bisher jede Krise überlebt hat, suchten viele Marxist*innen nach den Mechanismen hinter der Krisenbewältigung und fanden im Anschluss an Rosa Luxemburg die Kommodifizierung bisher unproduktiven Landes als einen bedeutenden Puffer. Klaus Dörre prägte im deutschen Raum hierfür den Begriff der kapitalistischen Landnahme. David Harvey erklärte die Accumulation by Dispossession sogar zur momentan dominanten Quelle des Profits. Und Anwar Shaikh brachte bereits 1986 den Begriff der Profits on Alienation in die Debatte ein. Alper Duman und E. Ahmet Tonak von den Universitäten in Izmir und Northhampton, MA wollten nun in der Review of Radical Political Economics wissen, wie groß denn der Anteil solcher Profite auf privatisiertes Land an der Gesamtproftmasse ist. Sie untersuchten hierfür das Fallbeispiel Türkei.
Weiterlesen