| ⋄ Depression besitzt aus epidemologischer Sicht eine Globalgeschichte, die eng mit dem Kapitalismus zusammenhängt. ⋄ Stefan Ecks wagt in seinem Buch Living Worth die These, dass die pharmazeutische Industrie einen neuen Begriff des Werts notwendig mache. ⋄ Ecks’ Wertbegriff beruht auf der Biokommensurabilität, nach der jedes lebende Subjekt Abwägungsentscheidungen zwischen nützlichen und schädlichen Optionen machen würde. ⋄ Der Kampf der pharmazeutischen Industrie gelte dem Kampf um die entsprechenden Vergleichsmaßstäbe und dringt auch in Kulturen ein, in den diese traditionell anders sind. ⋄ Ecks kritisiert auch den Marxschen Wertbegriff, allerdings oberflächlich und nicht auf der Ebene der gesamtgesellschaftlichen Reproduktion des Kapitals. |
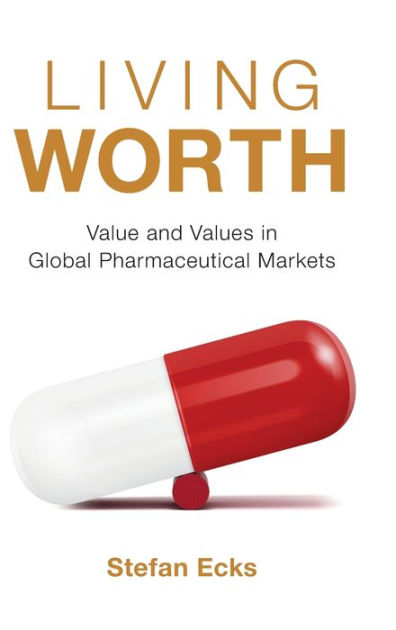
Das Medikament Prozac ist in den Vereinigten Staaten von Amerika eine Volksdroge. Das Antidepressivum hat sogar bereits den Eingang in die Popkultur gefunden – in Woody-Allen-Filmen oder bei den Sopranos – und Reklametafeln fragen ganz direkt: „Haben Sie mit ihrem Arzt bereits über Prozac gesprochen?“. Passend dazu hat sich auch die Diagnose Depression wie eine Epidemie über das Land gelegt. Ob es da wohl einen Zusammenhang gibt? Der Anthropologe Stefan Ecks lebte lange Zeit in Indien und wunderte sich, dass der kulturelle Umgang mit der Krankheit und dem Medikament ein ganz anderer war, obwohl Gesundheit in Indien ein fast noch wichtigeres Thema ist als hierzulande. Er fragte Bekannte nach Fluoxetin – dem Wirkstoff von Prozac – und diese erläuterten ihm, dass es sich bei dem Medikament keinesfalls um ein Antidepressivum handele, sondern um ein Mittel gegen Magenleiden. Erst, wenn auch der Kopf frei sei, könne der Bauch arbeiten.
Für den Anthropologen öffnete sich ein spannendes Feld: Welchen Wert haben Medikamente und Krankheiten in verschiedenen Kulturen? Warum wird Depressionen im Westen ein ganz anderer Wert beigemessen als im Osten? Und wie kommt er überhaupt zustande; der Wert? Und so entwickelte Stefan Ecks in seinem Buch Living Worth: Value and Values in Global Pharmaceutical Markets ein Konzept des Wertes, mit dem er auch den Begriff von Karl Marx zu widerlegen glaubt. Ob ihm das gelungen ist …
Der Gang des Buches
Zunächst schauen wir uns das Big Picture des Buches an und dann detailliert das Wertkonzept, welches vertreten wird. Ecks beginnt mit einer Definition, die den Wert als eine eine intrinsische Konstante des Lebens nachzeichnet. Beständig würde jeder lebende Organismus seine Umwelt danach bewerten, ob sie dem eigenen Leben zum Guten oder Schlechten gereicht. Das Individuum könne dabei nach sehr unterschiedlichen Maßstäben urteilen. Depression sei die Unfähigkeit, diese Bewertungen zu treffen inklusive den Wert des eigenen Lebens richtig einzuschätzen. Mit dem Kapitalismus sei Depression deshalb so stark verbunden, weil dieser die Menschen zur beständigen Bewertung zwinge. Besonders im Neoliberalismus würden bestimmte Bewertungen gesellschaftlich stark vorgegeben, wodurch das individuelle abweichende Urteil marginalisiert werde.
Die pharmazeutischen Konzerne würden ihren gesellschaftlichen Einfluss dazu nutzen, die Maßstäbe der Bewertung dahingehend zu verschieben, dass sie nach diesen gut abschnitten. So beeinflusst Pfizer durch vermeintliches zivilgesellschaftliches Engagement das Narrativ, in der kapitalistischen Peripherie seien depressive Erkrankungen akut unterbehandelt. Ecks führt hier das Konzept der „pharmazeutischen Staatsbürgerschaft“ ein, die eine bestimmte Methodik der Behandlung legal und legitim mache und für die es einiges an Lobbyarbeit bedürfe. Insbesondere in postkolonialen Staaten würde durch eine Etablierung westlicher Medizin eine Demarginalisierung versprochen. Tatsächlich verspräche die Werbung in Indien nicht nur die Behandlung von Depression, sondern lege eine Linderung aller Marginalisierungserfahrungen nahe. Es sei schon fast ein Ausdruck von Lifestyle, wenn der Arzt um die Ecke das gleiche Medikament verschreibe wie der aus New York. Die pharmazeutische Industrie fordere damit insbesondere in Indien eine Hindu-Tradition heraus, die das körperliche Wohl eng mit mentaler Stärke verknüpfe. Hier werde insbesondere der Kauf oder die Einnahme von Medikamenten skeptisch gesehen, da dies die Abhängigkeit von der Außenwelt verstärke. Überhaupt habe sich zwar die globale Kommunikation verstärkt, jedoch gäbe des eine Monokultur des Glücks, die als Maßstab negative Vergleiche und damit das steigende Risiko von Depressionen in die kapitalistische Peripherie exportiere. Die kapitalistische Globalisierung zerstöre gebräuchliche Solidaritätsnetzwerke, wobei der atomisierte Umgang mit Krankheiten in der Form medikamentöser Behandlung diese Atomisierung der Gesellschaft reflektiere. Der DSM-5 (Katalog anerkannter psychischer Krankheiten) sei symbolischer Ausdruck dafür, alle Krankheiten trotz kulturell vollkommen unterschiedlicher Einbettung, auf einen Nenner bringen zu wollen. Der DSM-5 berücksichtige zwar kulturelle Einflüsse auf Krankheiten, aber gerade durch diese Explikation würden die Krankheiten, in denen kulturelle Einflüsse nicht genannt würden, als interkulturell gleichförmig dargestellt. Nichtbehandlung nach DSM werde von einigen Organisationen sogar als Menschenrechtsverstoß gewertet.
Biokommensurabilität
Der Argumentationsgang entbehrt ohne Zweifel nicht einer intellektuellen Attraktivität, verarbeitet er doch gleichzeitig philosophische, ökonomische und politische Debattenstränge. Doch schauen wir uns etwas vertieft den zugrunde liegenden Wertbegriff an, um ihn auf Herz und Nieren zu prüfen. Ecks geht zunächst davon aus, dass jede Wahl oder jeder Tausch eine Abwägung zwischen Nutzen und Schaden einer Sache ist. Um jedoch überhaupt Nutzen und Schaden miteinander vergleichen zu können, bedürfe es eines gemeinsamen Maßstabes, den Ecks als Biokommensurabilität (das von Ecks genutzte englische Wort biocommensuration liest sich aktiver, hat jedoch keine deutsche Entsprechung) bezeichnet. Dieser Maßstab sei kulturell geprägt und könne selbst zwischen zwei Vergleichsgrößen variieren. Zwei unterschiedliche Produkte von generischen Medikamenten beispielsweise können den gleichen Wirkstoff besitzen, aber sie können sich in Verpackung, Anwendungspraxis und gesellschaftlicher Legitimität unterscheiden. Wenn also irgendwo ein Vergleich stattfindet, seien an diesen Vergleich sechs Fragen zu stellen, um die Qualität des Vergleichs zu bewerten: Was ist das vergleichende Dritte? Wie hoch ist der Grad der Gleichheit des vergleichenden Dritten? Wie relevant ist diese Gleichheit? Für wen ist sie relevant? Welche pragmatische Operation macht den Vergleich möglich?
Ein Beispiel: Wenn ein Pharmakonzern ein neues Medikament auf den Markt bringt, muss er entweder plausibel machen, dass das neue Medikament als einziges in der Lage ist, ein Leid zu lindern oder zumindest besser als die Alternativen. Gibt es keine Alternativen, gibt es keinen Vergleich außer dem individuellen zwischen Wirkungen und Nebenwirkungen. Gibt es hingegen Alternativen, wird ein werbender Konzern sich auf ein vergleichendes Drittes konzentrieren, in dem das neue Medikament tatsächlich einen Vorteil birgt. Dieses kann auch nur für eine besondere Zielgruppe relevant sein, die man dann mit entsprechenden Werbestrategien besonders anspricht. Diese Werbestrategien führen sogar zu unterschiedlichen Bewertungen, ob es sich nun um ein Medikament für eine Krankheit oder ein Lifestyleprodukt handelt. Manchmal machen auch umgekehrt Pharmakonzerne Lobbyarbeit dafür, dass ein Leiden offiziell als Krankheit anerkannt wird, um das Medikament dazu zu vermarkten.
Der entsprechende Vergleich bzw. Tausch werde natürlich unter bestimmten Rahmenbedingungen ausgetragen, die ihn beeinflussen. Die Tauschenden können einen Statusunterschied aufweisen oder beide einem Status angehören, der die Alternativen begrenzt. Die Gesellschaft setzt moralische Grenzen. Sie können einem persönlichen Verhältnis unterliegen und bringen natürlich individuelle Bewertungen mit ein. Auch die Zeit ist ein Faktor.
Von der Biokommensurabilität zum Wert
Wert sei nach Ecks nun jede Biokommensurabilität in Bezug auf das Leben. Daher spricht Ecks auch von einem verkörperten Wert. Was Leben erhält oder verbessert, hat großen Wert; was ihm schadet, hat kleinen Wert. Nach Luhmann bestehe das dritte Gemeinsame in der Selbstähnlichkeit aller lebenden Dinge, die eine Grenze zwischen der belebten und der unbelebten Natur ziehe. Jeder lebende Organismus ziehe beständig Vergleiche zwischen lebenserhaltenden und lebensverkürzenden Optionen und bewerte so seine Umwelt. Ecks nimmt auch Bezug zur Theorie der freien Energie (vergleiche hier). Einen Beweis für seine Behauptung sieht Ecks in der Inkommensurabilität des menschlichen Lebens. Da sich jeder Wert auf das Leben beziehe, sei das Leben selbst vom Vergleich ausgenommen, da es für sich selbst keinen Bezugspunkt darstellen könne.
„To create value means to enhance life. To enhance life, possibilities must be weighed against one another. To value means to compare two or more possibilities and to choose what enhances life. Life cannot not value.“
S.35
Dann wendet sich Ecks den bestehenden Werttheorien zu. Zunächst der kulturellen Werttheorie. Ihr, insbesondere in der Auslegung von David Graeber, kann Ecks viel abgewinnen. Er präzisiert lediglich. Der kulturelle Wert sei der symbolische Ausdruck des Werts an sich. Allerdings könne der kulturelle Wert nur die Über- oder Unterordnung bestimmter Werte beschreiben, jedoch nicht, wie der Wert an sich entstehe.Mit der subjektiven Werttheorie verbindet Ecks, dass der Tauschwert nicht auf messbare Parameter zurückgeführt werden kann; jedoch kritisiert er, dass der Wert letztendlich nur ein Produkt des Verstands sei und nicht der Ware inhärent.
Positiv an Marx sieht Ecks, dass Marx mit der Herleitung des Werts über die verkörperte Arbeit oder den Wert der Ware Arbeitskraft über die Preise der Waren zu ihrer Reproduktion die lebendige Arbeit zur Quelle des Werts macht. Dass allerdings die Arbeit nicht die einzige Quelle des Werts sein könne, begründet er wie folgt:
„The idea that labor time alone can measure value is clearly wrong: ten hours spent building a sandcastle is not valuable in the same way as ten hours spent marking students’ essays.“
S.65
In diesem Satz sind gleich zwei Missverständnisse der Marxschen Werttheorie enthalten. Es geht Marx um die gesellschaftlich notwendige Arbeit und das umfasst zwei Apekte: Erstens muss die Ware einen gesellschaftlichen Gebrauchswert haben – was für Sandburg und Essay ganz verschieden ausgehen kann – und die Ware muss zur durchschnittlich notwendigen Arbeitszeit hergestellt werden … beim Essayschreiben Bummeln macht ihn nicht wertvoller.
Die Hauptkritik von Ecks ist aber Marxens vermeintlicher Reduktionismus. Arbeit sei unbestreitbar eine Quelle von Wert, aber sie könne nicht die einzige sein.
„Marx may be aware of the immense heterogeneity of both use value and concrete forms of labor
S.66
(Harvey 2018: 43). But Marxian theory still reduces everything to the useexchange binary and ignores a universe of other forms of value creation.“
Zunächst einmal hat Marx nicht bestritten, dass es andere Quellen des Wertes gibt, etwa den Boden. Nur der Mehrwert ist nach Marx einzig und allein durch die lebendige Arbeit bestimmt. Ecks übersieht ebenso, dass Marxens Dualismus von Gebrauchswerten und Tauschwerten eine dezidierte Kritik der bürgerlichen Gesellschaft darstellt. Die Mannigfaltigkeit der Gebrauchswerte – und der Begriff der Gebrauchswerte enthält Ecks’ Biokommensurabilität vollständig – stellt er dem Zweck der Profitökonomie gegenüber, welche ersteres nur zum Mittel degradiere. Weil Gebrauchswerte und konkrete Arbeiten so heterogen sind, im Geld alle Waren jedoch auf einen Nenner gebracht werden müssen, braucht es einen Maßstab und es findet sich kein anderer, außer in der Eigenschaft, Produkte menschlicher Arbeit zu sein. Das bedeutet nicht, dass es nicht potentiell andere geben würde, aber dieser Maßstab ist das historische Produkt der bürgerlichen Gesellschaft, in der die Herrschaft der Bourgeoisie auf der Aneignung fremder Arbeit beruht.
Nun könnte man natürlich sagen, dass der Wertbegriff, den Ecks verwendet, eben nicht der Marxsche ist, der sich historisch spezifisch auf die kapitalistische Gesellschaftsform bezieht, sondern ein übergreifenderer, der sowohl Tauschwert und Gebrauchswert mit einschließt. Allerdings stellt Ecks ganz konkret die Behauptung auf, dass der ökonomische – und damit kann nur der bürgerlich-kapitalistische – Wertbegriff axiomatisch mit der Gesamtheit an biokommensurablen Vergleichen verbunden. Das ist auch nach Marx richtig, da jede Ware einen Gebrauchswert besitzen muss, um Tauschwert zu besitzen, aber eben nicht in der Argumentation von Ecks, der nicht erklären kann, warum trotz einer Vielzahl an Maßstäben die Medikamente doch für jede*n Käufer*in den gleichen Preis haben.
Wie die Marxsche Theorie richtig anwenden?
Nun ist der pharmazeutische Sektor natürlich prädestiniert dafür, die Marxsche Arbeitswertlehre zu attackieren, da viele Medikamente gar nicht in freier Konkurrenz verkauft werden. Dennoch finden sich Preise, die manchmal das investierte Kapital um ein Vielfaches überschreiten. Tatsächlich lassen sich die Erklärungen nicht mit der einfachen Arbeitswertlehre nach dem ersten Band des Kapitals finden, sondern es muss schon die Reproduktion des Gesamtkapitals nach Band 3 in den Blick genommen werden.
Wenn ein Pharmaunternehmen ein neues Medikament herstellt, unterliegt dieses für einen längeren Zeitraum dem Patentschutz. Die Gesetze der freien Konkurrenz können also hier nicht wirken und die Monopolunternehmen können Monopolrenten einfahren, die sich aus der ausschließlichen Verfügbarkeit über die Ware speisen. Das erkennt auch Stefan Ecks:
„And most of what is happening in the bioeconomy is not about commodities but about other
S.67
forms of assets, such as intellectual property rights.“
Es wäre jedoch nun ein absoluter Fehlschluss zu glauben, in einer auf der Warenproduktion beruhenden Gesellschaft gebe es keine bestimmbaren Verbindungen zur Warenproduktion. Hier wirken mehrere von Marx im dritten Kapital-Band explizierte Gesetze. Erstens handelt es sich bei den Profiten auf Patentprodukte nicht um Unternehmerprofite, sondern um Renten. Renten sind vom Staat garantierte Rechtstitel, die im Fall der Monopolrente – also dem Fehlen einer Alternative – tatsächlich zu überdurchschnittlich hohen Gewinnen führen kann. Allerdings werden diese Rechtstitel stark kontrolliert und wenn die enormen Rentengewinne drohen, die produktive Ökonomie zu ruinieren, weil entsprechende Sektoren sämtliches Kapital aufsaugen, legt der ideelle Gesamtkapitalist sehr schnell die Daumenschrauben an.
Das muss er in der Regel aber nicht, da zweitens der Hebel des Ausgleichs der Profitraten wirkt. Wäre die Pharmaindustrie ein Quell maßloser Bereicherung, würde jedes Kapital hier investieren. Es käme schnell zu einer Kapitalübersättigung, der Mehrwert würde nur noch in Bezug auf immer größere Mengen an Kapital gemessen und die Profitraten sänken sehr schnell. Kleine Startups wirken mit ihren enormen Profitraten daher immer mal wieder beeindruckend. Aber Ecks führt in seinem Buch selbst aus, dass der Fall des Patentschutzes sogar eher der Ausnahmefall ist. 80% aller in den USA verschriebenen Medikamente seien ohnehin patentfrei und es sei eher die Flut an verschiedenen Marken des gleichen Produkts das Problem anstatt der Monopolstellung. Große Konzerne wie Bayer verlassen sich lieber auf die produktiven Profite statt politisch stets vakante Patentrenten, die sich am Ende ohnehin nur an der Durchschnittsprofitrate orientieren können.
Und drittens findet ein Monopolpreis, wenn es möglich ist, seine Grenze in den Kosten der Alternative. Ein Medikament gegen Depressionen beispielsweise findet seinen Grenzpreis in den Kosten für eine alternative psychiatrische Behandlung. Damit die weit nützlichere Therapie nicht dem Medikament vorgezogen wird, muss das Medikament sogar deutlich preiswerter sein, selbst wenn es sich um ein Patentmonopol handelt.
Die Pharmaindustrie gibt also aus marxistischer Sicht durchaus Rätsel auf, aber keine unlösbaren Rätsel, wenn man auf der Ebene der Gesamtreproduktion des Kapitals analysiert.
Zusammenfassung
Der große Nutzen von Ecks’ Buch ist, dass er die Ausdehnung der pharmazeutischen Bewältigung von Depressionen nicht auf die verkürzte wie nichtssagende Aussage, es ginge nur um Profite, herunterkürzt. Er versucht das Phänomen durch eine allgemeine Charakterisierung des globalen Umbruchs zu charakterisieren, der in seiner Totalität erfasst werden muss. Da kann man ihm nur zustimmen. Wiederum gelingt Ecks nicht die konsistente Einhegung dieser Totalität. Wie an der Perlenschnur lässt Ecks alle großen Philosophen und Soziologen der Moderne aufwarten – Luhmann, Bourdieu, Sloterdijk, u.v.m. – als ob sich alle mal so widerspruchsfrei zur Analyse eines Phänomens heranziehen ließen. Ecks wird somit weder dem Thema noch den großen Denkern gerecht. Es bleibt bei einer unsystematischen Annäherung an das Thema. Dieses Genre ist aktuell sehr beliebt und wer ist mag, der wird das Buch mit Vergnügen lesen. Aber das allein ist eben kein Argument gegen den systematischen Ansatz von Marx.
So scheitert auch letztendlich Ecks’ Kritik an Marx. Die Frage des Tauschwerts bzw. des Preises von pharmazeutischen Waren lässt sich mit Hilfe der Marxschen Analyse der gesellschaftlichen Reproduktion des Gesamtkapitals – inklusive der Instrumente wie Monopolrenten und Monopolprofiten – sehr wohl erklären. Zumindest beweist Ecks nicht das Gegenteil und strebt diesen Beweis auch nicht an. Er verbleibt auf der Darstellungsebene des ersten Kapitalbandes und das auch nur in sehr oberflächlicher Manier.
Was Ecks allerdings leistet, ist, den Kampf um die Anerkennung als Gebrauchswert, der notwendigerweise zur Warenform gehört, am Beispiel der Depression darzustellen. Er stellt die Versuche dar, verschiedene Gebrauchswerte kommensurabel zu machen und wie der Kampf um die Vergleichskriterien zu Widersprüchen und Konflikten zwischen globalen Krankheiten und lokalen Behandlungsmethoden, zwischen Patient, Arzt und Pharmaunternehmen und zwischen kapitalistischer Peripherie und den Zentren führt. Und hier ist das Buch sogar eine Modernisierung und in wesentlichen Teilen auch eine Verbesserung von Wolfgang Pohrt’s Kritik des Gebrauchswerts. Und mit dieser gedanklichen Modifikation ist Living Worth auch für Marxist*innen mit Gewinn lesbar.
Literatur:
Ecks, S. (2022): Living Worth: Value and Values in Global Pharmaceutical Markets. Durham: Duke University Press.
