| ⋄ Seit Marxens Kritik an den Frühsozialisten wird der Begriff der Utopie in der sozialistischen und kommunistischen Bewegung häufig als Gegenteil zur Wissenschaft aufgefasst. ⋄ Nachdem der Realsozialismus jedoch viele Revolutionär*innen enttäuscht hatte, haben einige Theoretiker*innen die Utopie als wissenschaftliche Methode neu entdeckt. ⋄ Die Review of Evolutionary Political Economics versammelte in seiner letzten Ausgabe verschiedene Aufsätze über marktsozialistische, partizipative und cyberkommunistische Simulationen oder Diskussionen von Utopie. ⋄ In der deutsch-österreichischen COMMONISMUS-Simulation wurde beispielsweise eine Gesellschaft modelliert, in dem Produktionsgemeinschaften in freiwilliger Kooperation für Bedürfnisse produzieren. ⋄ In darauf aufbauenden Experimenten zeigte sich, dass die kapitalistische Leistungskultur in einer an menschlichen Bedürfnissen orientierten Ökonomie nicht überlebensfähig ist. |
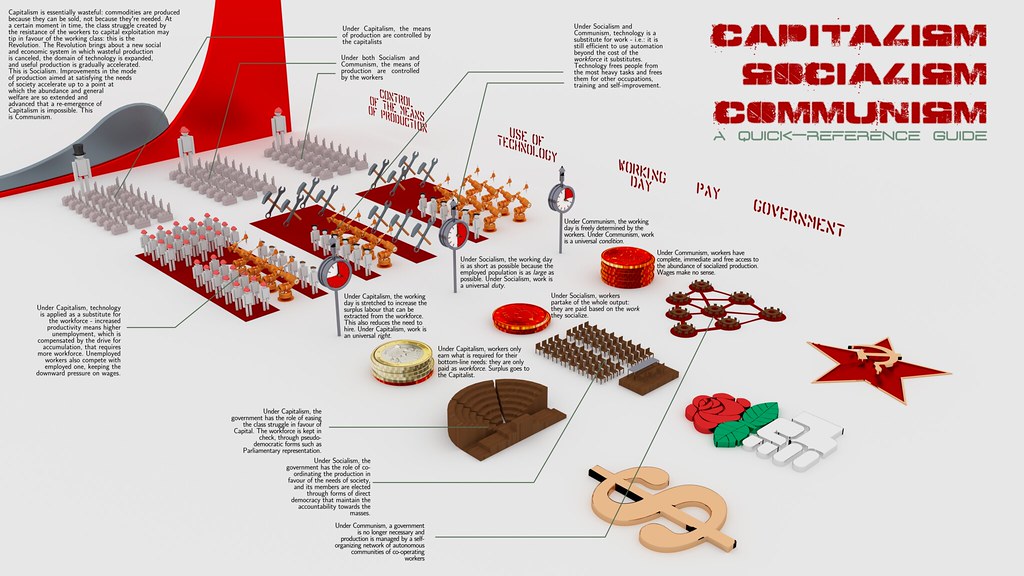
Wie allgemein bekannt hat Karl Marx die utopischen Sozialisten dafür kritisiert, dass sie sich Systeme für ein vermeintlich perfektes Leben ausgedacht haben, an denen sie die Wirklichkeit gemessen haben, anstatt aus der Logik der Wirklichkeit heraus eine Kritik der bürgerlichen Produktionsweise zu entwickeln. Einige Marxist*innen sehen jedoch in einer zu starren Interpretation des Gangs von der Utopie zur Wissenschaft den Verlust der Perspektive und des Auswegs aus der Affirmation des Bestehenden. Sie wenden ein, dass Utopie ein Element der Wissenschaft sein kann und muss. Hat denn nicht auch der Revolutionär, anders als die Baumeister Spinne und Biene, sein Werk im Kopf schon vollendet, bevor er den ersten Schritt tut? Muss man nicht auf die Gegenargumente, moderne Gesellschaften seien zu komplex und individuell strukturiert, um sie gemäß den Bedürfnissen zu planen, auch empirisch reagieren können? Daher erheben einige Wissenschaftler*innen die Forderung nach einem utopischen Realismus anstelle des Utopieverbots. Sie sehen in immer mächtigeren Algorithmen eine Möglichkeit, dem Sozialismus mit Hilfe des Computer ein wenig vorzugreifen.
Die aktuelle Ausgabe der Review of Evolutionary Economics hat verschiedene Aufsätze über die wissenschaftliche Kartographierung postkapitalistischer Utopien versammelt. Sowohl marktsozialistische, partizipative oder cyberkommunistische Modelle wurden hier hinsichtlich ihrer Operationalisierbarkeit und Aussagekraft geprüft; mit einigen spannenden Erkenntnissen und vielen offenen Fragen.
COMMONISMUS und Commonismus
Der zentrale und auch der spannendes Aufsatz der Ausgabe handelte vom COMMONISMUS-Projekt von Gerdes, Meretz, Sutterlütti und weiteren. Das Projekt läuft nun schon mehrere Jahre und wurde bereits von einigen Zeitungen und Podcasts aufgegriffen. Finanziert wurde es in zwei Stufen von der Volkswagen-Stiftung, die im Zuge der Diskussion um den scheinbaren Niedergang der Arbeitsgesellschaft auch einen postmonetären Ansatz fördern wollte. 2018 erschien nach der ersten Verständigungsphase das Buch Kapitalismus aufheben im VSA-Verlag und seither wurde eine Simulation implementiert. Im hier vorgestellten Aufsatz wurden bereits Experimente mit dieser durchgeführt. Das ist das neue. Knapp gesagt ging es darum, eine in Commons oder Gemeinschaften/ Räten organisierte Gesellschaft zu simulieren, in denen Gruppen von Individuen sich je nach Erfahrungen, Fähigkeiten und Bedürfnissen auf freiwilliger, aber verbindlicher Basis organisieren und dabei Entwicklungen zu untersuchen. Bevor wir auf die Logik der Simulation eingehen, sollen zunächst ein paar Worte zu den psychologischen und politischen Grundlagen des Commonismus-Konzeptes von Sutterlütti und Meretz verloren werden.
Der Begriff Commonismus ist ein Wortspiel aus Kommunismus und dem englischen Wort Common für Gemeingut oder Allmende. Anders als in vielen cybersozialistischen Utopien, in denen die Wirtschaft weitestgehend zentral über digitale und partizipative Feedbackmechanismen geplant wird, geht der Commonismus von kleinen Organisationsstrukturen auf freiwilliger Basis zur Erfüllung menschlicher Bedürfnisse aus. Diese Bedürfnisse können materieller Natur sein – also Kollektivbetriebe zur Herstellung benötigter Güter wie Landwirtschaften, Bäckerein oder Softwarebüros – oder immaterieller Natur sein, wie Kindergärten, Schulen, Krankenhäuser oder Organisationsleistungen. Innerhalb eines Commons organisieren sich die Individuen selbstständig, demokratisch, partizipativ und den Bedürfnissen ihrer Mitglieder entsprechend. Nach außen hin treten sie in Austausch mit verschiedenen anderen Commons, um Inputgüter zu erhalten oder selbst hergestellte Güter gesellschaftlich zu verteilen. Commons geben sich eigene Regelwerke, die auch den Austausch nach außen determinieren (Die Öko-Hippie-Kommune wird ihre Ernte nicht als Futter für den Schweinemastbetrieb hergeben). Durch die Interaktion der Commons entsteht damit ein Netzwerk, dass sich evolutionär hochkomplexen Fertigungsketten oder auch gegenteilig zu eher fragmentierten Produktionseinheiten führen kann, je nach dem wie die Bedürfnisse am besten zu befriedigen sind.
Das zugrunde liegende Menschenbild setzt rational entsprechend ihren Bedürfnissen, Emotionen, Motivationen und Wahrnehmungen handelnde Individuen voraus, wobei die Befriedigung eines Bedürfnisses das wesentliche Anreizsystem zur Aktivierung der Fähigkeiten in praktischer Arbeit ist. Bedürfnisse werden hier nicht vermittelt über einen abstrakten Tauschwert wie Geld gedacht, sondern an der sensual-vitalen Befriedigung gemessen. Je nach Erfolg, Selbstwirksamkeitserfahrungen und persönlichen Vorlieben können Mitglieder der Commons diese verlassen. Makroskopisch gesehen sind die Produktionsmittel im Commonismus Eigentum der Werktätigen. Der Großteil der Ressourcen ist dabei an die Commons gebunden und kann nicht individuell angeeignet werden. Organisatorische Commons bilden sich je nach Bedarf heraus und nehmen den Commons, wenn es der Befriedigung der Ziele dient, einen Teil der Autonomie ab.
Die Rahmenbedingungen der Simulation
Dem Team um Gerdes, Meretz und Sutterlütti musste nun dieses Konzept in ein konkretes Programm gießen. Dazu wurden die einzelnen Individuen in jeweils zwei Gruppen pro Agent eingeteilt.

Einmal sind sie Teil einer familienartigen Lebensgemeinschaft aus bis zu zehn Personen, die einen Teil der Reproduktionsarbeit übernehmen und sich stark emotional beeinflussen und in Produktionsgemeinschaften, die entweder natürliche Ressourcen abbauen, wiederherstellen, auf verschiedenen Stufen der Produktion arbeiten, Fürsorge oder andere soziale Dienste ausführen. Die einzelnen Produktionsgruppen bestehen aus demokratietheoretischen Gründen aus maximal 300 Mitgliedern. Die ganzen Commons bilden damit ein großes Netzwerk und schöpfen aus dem natürlichen und kulturellen Inventar der Gesellschaft, um die ex ante formulierten Bedürfnisse der Individuen zu befriedigen. Je höher eine Gruppe in der Fertigungskette arbeitet, umso produktiver wird sie angenommen, auch wenn beispielsweise ein Minen-Unternehmen einen hohen Ausstoß an Rohmaterial pro Arbeiter*in besitzt. Tritt irgendwo ein Mangel in der Produktionskette auf, wird die Bereitschaft der Individuen, diese durch Neuorganisation der Commons zu schließen, vorausgesetzt.
Verhalten der Agenten
Gefüllt werden die Commons mit Agenten, also simulierten Menschen, die auf die Rahmenbedingungen der Produktion in verschiedenen definierten Weisen reagieren können. Ein besonderes Merkmal der COMMONISMUS-Simulation ist, dass diese Agenten drei verschiedene kulturelle Vorlieben haben können. Ökologisch orientierte Agenten sind eher altruistisch, bevorzugen freie Zeit vor materiellem Wohlstand und produzieren weniger intensiv. Traditionelle Agenten sind leistungsorientiert, produzieren effizient, denken eher egoistisch und legen weniger Wert auf Nachhaltigkeit. Modernisten versuchen aus altruistischen Beweggründen einen Ausgleich zwischen materieller Produktion und Nachhaltigkeit zu finden, indem sie möglichst produktiv arbeiten. Darüber hinaus gibt es einen Pool an nicht definierten Agenten, bei denen die kulturellen Vorlieben zufällig zusammengesetzt sind. Die Simulation geht nun davon aus, dass Agenten die kulturellen Eigenschaften ihrer Gruppen mit einer gewissen Wahrscheinlichkeit und Ausprägung adaptieren. Wechselt eine Individuum die Gruppe, bedeutet das, dass die neue Gruppe Überzeugungen einer anderen übernehmen kann. Je egoistischer ein Agent ist, desto geringer ist jedoch seine Adaptivität.
Das Ziel eines jeden Agenten ist, dass seine materiellen und sozialen Bedürfnisse befriedigt werden. Jedes Individuum besitzt für beides ein Existenzminimum, die Zufriedenheit steigt jedoch bis zu einem Schwellwert mit einem höheren Grad an Erfüllung. Je nach Egoismus-Grad wird dafür jedoch mehr Input benötigt. Je größer die Zufriedenheit ist, desto weniger Konsumbedürfnisse müssen von der Gesellschaft gestillt werden. Die Simulation geht also davon aus, dass ein gewisser Grad an Konsumtion als Ersatzhandlung für mangelndes Wohlbefinden fungiert. Interessanterweise sieht die Simulation es auch als Bedürfnis an, sich sinnstiftend in die Gesellschaft einzubringen. Agenten mit hohem Freizeitbedürfnis haben davon zwar weniger, wenn jedoch ein Common de facto überflüssig ist, werden die produktiven Bedürfnisse eines oder mehrerer Mitglieder nicht mehr gestillt und der Agent wechselt selbstständig an einen Ort, an dem Arbeitskraft gebraucht wird. Die Agenten setzen sich ebenso Ziele, welche Produkte sie gerne in Zukunft konusmieren wollen und ihre Emotion wird als Reflexion dieser Zielerreichung interpretiert. Entsprechend dieser Ziele wechseln Agenten in die für sie priorisierten Commons, können diese aber auch verlassen, wenn dort ihre produktiven Bedürfnisse nicht gestillt werden.
Experimente
All diese Kalküle wurden in der COMMONISMUS-Simulation nun in einen schrittweisen Algorithmus übersetzt, der rundenbasiert Netzwerke aus den beschriebenen Organisationsformen mit den verschiedenen Agenten erstellt. Nach jeder Runde werten die Agenten aus, wie ihre Ziele erreicht wurden und wie sie sich umgruppieren müssen, um ihre Ziele besser zu erreichen. Alle zwölf Simulationsschritte reagieren die Agenten auf die berechneten Outputs und die Commons schließen neue Verbindungen oder kappen alte. Die Experimente, welche die Forschergruppe nun durchführte, bezogen sich auf die Auswahlkriterien für die Verteilung der geschaffenen Güter. Bei der inklusiven Allokation haben die Commons die Netzwerke unabhängig von der kulturellen Zusammensetzung allein nach Bedürfnisbefriedigung gebildet. Zum Beispiel: Die veganen Biobauern erkennen an, dass die Verwertung ihrer Produkte als Futtermittel gesamtgesellschaftlich am meisten zur Bedürfnisbefriedigung beitraägt, auch wenn sie mit dem Bedürfnis nicht d’accord gehen. Demgegenüber steht die exklusive Allokation. Jede Kultur bleibt unter sich. Die arbeitswütigen Traditionalisten denken nicht daran, freizeitliebende Ökos querzusubventionieren (hier gibt es eine Pointe). Als dritte Form hat das Team eine kulturabhängige Mischform etabliert, in der zwar nach Kultur präferiert wird, aber eben Zusammenarbeit nicht ausgeschlossen wird.
Jedes dieser Settings wurde nun jeweils 100 mal durchgespielt, wobei jedes Szenario 2000 Iterationsschritte durchlaufen hat, was einer Dauer von etwa 40 Jahren in realer Zeit entsprechen würde. Ein wenig überraschender Befund war, dass die inklusive Allokation die stabilste Versorgung zur Folge hatte. Tritt in der Fertigungskette eines kulturspezifischen Inventars ein Mangel auf, kann er schnell durch andere Gruppen behoben werden. Wesentlich interessanter war die kulturspezifische Allokation.

Ausgerechnet die Traditionalisten geraten recht schnell in eine Krise und sind auf Transfers über die Lebensgemeinschaften und Produktionsgruppen angewiesen, während die ökologische Kultur ihr Inventar recht schnell steigert und dann an andere Gruppen teilt. Vielleicht könnte man es so interpretieren, dass die Traditionalisten sehr viel konsumieren, dafür auch sehr viel materielle Güter produzieren müssen und immaterielle Arbeit wie Carearbeit zu kurz kommt. Der hohe Materialbedarf führt schnell zu Versorgungskrisen, während gleichzeit die hohe Produktivität viele überflüssige Menschen produziert. Diese muss dann aus den entsprechenden anderen Gruppen entnommen werden, während diese keinen entsprechend hohen Bedarf an den materiellen Gütern der Traditionalisten haben. Bei der exklusiven Allokation führt das dazu, dass die traditionelle Kultur bereits nach nicht einmal zehn Jahren ausgestorben ist. Die Pointe hier ist, dass diese Kultur die im Kapitalismus präferierte ist.
Allerdings ist die ökologische Gruppe in jedem Szenario die am schnellsten schrumpfende Gruppe. Altruismus scheint nicht prinzipiell glücklich zu machen. Im Gegenzug steigt in jedem Szenario die Anzahl zufällig zusammengesetzter Agenten. Durch die Netzwerkarbeit gleichen sich also stabile kulturelle Muster mit der Zeit aus und verschwimmen. Auch die Zufriedenheit ist am größten, wenn die Allokation inklusiv ist. Die durchschnittliche Entfernung der einzelnen Produktionseinheiten – und damit Zirkulationskosten – ist hier ebenfalls am geringsten. Das ist plausibel. Wenn ich eine Ressource nur aus der eigenen kulturellen Gruppe schöpfen kann, ist die Wahrscheinlichkeit, dass sich diese gerade in der Nähe befindet geringer.

In einem weiterführenden Experiment wurde untersucht, wie die Krisensituationen bei exklusiver Allokation institutionell behebbar wären. Erstens wurde ein gemeinsamer Pool an kritischen Gütern konstruiert, in den jeder Common einzahlt und aus dem sich jeder Common nehmen kann. Und zweitens wurde interkultureller Austausch für (fast) überschüssige Waren zugelassen, insofern ein entsprechender Gegenwert gezahlt wurde, also so etwas wie ein beschränkter Tauschsektor (indirekte Reziprozität). Beide Maßnahmen haben sich als etwa gleich geeignet erwiesen, die Krisenauswirkungen des exklusiven Szenarios zu beheben, sodass auch exklusive Allokation mit institutioneller Begleitung als funktionabel erscheint. Interessant ist aber, dass sich die indirekte Reziprozität nach überstandenen Krisen wieder verflüchtigt hat und die regulären Common-Strukturen wieder ihre Arbeit aufgenommen haben.
Zusammenfassung
Die COMMONISMUS-Simulation ist mehr als eine nette Spielerei. Durch die Nachbildung einer an Bedürfnissen, Motivationen, Emotionen, Fähigkeiten und kulturellen Mustern orientierten Gesellschaft können Probleme aufgedeckt werden, die revolutionstheoretisch bisher noch nicht berücksichtigt wurden, aber auch das Verlangen, eine immerhin im Computer machbare wünschenswerte Gesellschaft in der Realität aufzubauen, wird geweckt. Die Simulation bestätigt die These von Marx, dass der homo economicus nur ein psychisch-kultureller Reflex auf eine warenproduzierende Gesellschaft ist, der unter anderen Produktionsprämissen nicht überlebensfähig wäre.
Natürlich verhalten sich die Agenten so, weil sie so programmiert worden sind. Sie besitzen keine geldorientierten Handlungskalküle, weil es nicht Teil ihres Algorithmus ist und die Simulation kann hier auch nur wiedergeben, was sie als Input erhalten hat. Aber genau dieses Kalkül ist eben enorm voraussetzungsvoll und abstrahiert schon sehr weitgehend von den Muttermalen der alten Gesellschaft. Die praktische Aufgabe wissenschaftlicher Sozialist*innen ist, wie es Marx mit seiner Utopiekritik skizziert hat, die vermittelnden Schritte zwischen der bürgerlichen Gesellschaft und ihrer Bewusstseinsformen hin zu einer sozialistischen und später kommunistischen Gesellschaft zu bewerkstelligen. Diese Arbeit kann keine Simulation abnehmen. Man könnte aber die These wagen: Die Simulierung der Utopie ist bereits als ein solcher vermittelnder Schritt tauglich. Denn die so tiefe Operationalisierung einer Utopie, damit eine Computersimulation überhaupt sinnstiftend funktioniert, erfordert schon soviel Klarheit und Klärung, dass die Erstellung selbst der eigentliche Mehrwert jenseits der Experimente ist. In diesem Sinne erweist sich Utopiearbeit als fruchtbare wissenschaftliche Methode.
Literatur:
Gerdes, L.; Aigner, E.; Meretz, S.; Pahl, H.; Schlemm, A.; Scholz‑Wäckerle, M.; Schröter, J. & Sutterlütti, S. (2023): COMMONSIM: Simulating the utopia of COMMONISM. In: Review of Evolutionary Political Economics. Jahrgang 4. Ausgabe 4, S.559–595. Online abrufbar unter: https://link.springer.com/article/10.1007/s43253-023-00110-0.
Anmerkung:
Die weiteren Aufsätze der Ausgabe werden im Folgebeitrag besprochen.
